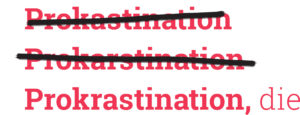Becci erklärt, was dieser Zungenbrecher bedeutet, woher das überhaupt kommt und was man dagegen machen kann
Für’s Protokoll: Dieser Artikel wurde natürlich zwei Tage nach Redaktionsschluss abgegeben. Ich bin nämlich ein Profi im Prokrastinieren. Dieses komplizierte Wort bedeutet so viel wie „aufschieben“ oder „vertagen“. „Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen!“ ist ein sehr tugendhafter Spruch, den ich in meiner Jugend häufig zu hören bekam. Aber auch jetzt habe ich noch Probleme damit, nervige oder anstrengende Aufgaben sofort zu erledigen, statt sie vor mir herzuschieben. Tatsächlich flüchte ich mich sogar teilweise in andere ungeliebte Tätigkeiten wie Aufräumen oder Putzen. Manchmal gebe ich aber auch komplett nach und schaue eine ganze Serie am Stück. Damit bin ich auch sicher nicht die einzige, vielen meiner Freund*innen und Bekannten geht es oft ganz genauso.
Doch woran liegt das? Viel schlauer wäre es ja, sich den Aufgaben direkt zu stellen und danach die Freizeit zu genießen.
Einige Psycholog*innen sind der Meinung, dass sich der Hang zum Aufschieben an bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen festmachen ließe. So sollen zum Beispiel Perfektionist*innen oftmals an ihrem Zeitmanagement scheitern, da sie sich zu sehr in kleinen Details verlieren. Andere Wissenschaftler*innen halten das hingegen nicht für die Antwort, haben aber das Prokrastinieren an sich beobachtet und dabei festgestellt, dass es zwei verschiedene Arten gibt: aktive und passive Prokrastination. Bei ersterem wird das Aufschieben lediglich genutzt, um genug Druck aufzubauen, der letztendlich zu einem konzentrierteren Workflow verhilft, da es nun ja wirklich getan werden muss. Letzteres bedeutet, dass unangenehme Aufgaben einfach so gut es geht vermieden werden.
Auch für die Tätigkeiten wie Putzen oder Serienschauen während der Prokrastination habe ich eine Erklärung gefunden: Es geht dabei um Dopamin. Das ist ein Botenstoff im Gehirn, der dafür zuständig ist, motivations- und antriebssteigernde Effekte zu transportieren. Dopamin gilt neben Serotonin als Glückshormon, da es einen Belohnungseffekt hervorruft. Zwar verspricht uns das Erledigen von Aufgaben am Ende auch eine Belohnung durch Dopamin, allerdings erscheint der Abschluss der Aufgaben uns meist sehr weit weg, außerdem bekommt man am Ende quasi nur ein einziges „Dopamin-Paket“. Schauen wir allerdings eine Serie oder räumen unser Zimmer auf, wird das Glückshormon viel häufiger ausgeschüttet und das auch noch viel früher als wenn man sich beispielsweise endlich dem Schreiben einer Arbeit widmet.
Ok, und was tun wir jetzt dagegen?
Das ist eine schwierige Frage, denn am Ende gilt es einfach, endlich den inneren Schweinehund zu besiegen. Einige Tipps habe ich natürlich trotzdem für euch: Sorgt selbst für kleinere Dopamin-Pakete zwischendurch. Ihr könntet zum Beispiel das Lernen für eine Klausur in kleinere Unteraufgaben wie Lernkarten schreiben, Auswendiglernen und Abfragen aufteilen und diese in einer To-Do-Liste festhalten. Mit jedem gesetzten Häkchen werdet ihr euch besser fühlen. Oder ihr versprecht euch materielle Belohnungen wie zum Beispiel Eiscreme für das Erledigen der Aufgabe. Außerdem könnte es hilfreich sein, euch der Ablenkungsmöglichkeiten zu entledigen. Schaltet das WLAN aus, legt das Handy in ein anderes Zimmer oder geht woanders hin, wo ihr nicht aufräumen müsst. Und für jeden, der das gerade braucht: Fühl dich in den Ar*** getreten und leg endlich los! Du kannst das schaffen!